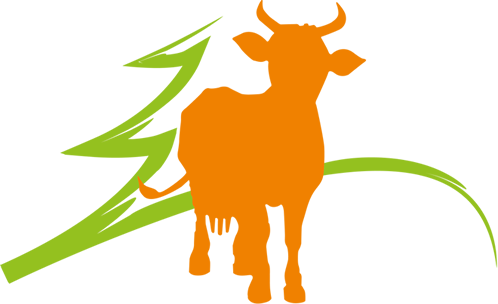
Tierzucht-Unterricht im Wandel der Zeit
Der Lungau, Pongau und der Bezirk Murau bieten auf Grund ihrer natürlichen Produktionsbedingungen gute Voraussetzungen für eine funktionierende Rinderwirtschaft. Durch die Vermittlung der klassischen Grundlagen in Viehzucht, Forstwirtschaft und Pflanzenbau, sowie der kommunalen Zusammenarbeit im Dorf und der Regionen werden die jungen Menschen auf einen späteren Berufseinstieg vorbereitet.
Meine Aufgabe als Tierzuchtlehrer ist und war es immer, junge Burschen und Mädchen dazu zu motivieren, über die Schule hinaus neugierig und interessiert zu bleiben. In der Vermittlung des Lehrstoffes werden die ethologischen Grundlagen, der Tierzucht, Anatomie, Fortpflanzung und verschiedene Produktionsverfahren und Besonderheiten in der Tierhaltung gelehrt. Weiters im speziellen die Zuchtmethoden, Zuchtwertschätzung und verschiedene Biotechniken.
Die Entwicklung der Tierzucht bis Mitte des 20. Jhdt. beruhte auf Erfahrungen und bewies, welche gewaltigen züchterischen Veränderungen ohne naturwissenschaftliche Grundlagen möglich waren. Die enorme Beschleunigung der Züchtung ab Mitte des 20. Jhdt. ist die Folge der Anwendung der Mendelgesetze (Vererbungsgesetze) in der Tierzucht.
Kenntnisse der Genetik sind heute unverzichtbares Basiswissen in diesem Unterrichtsfach. Wichtigste Voraussetzung für die züchterische Nutzung von Merkmalen (egal ob Rind oder Pferd) ist die Bewertung der im Zuchtziel festgelegten Merkmale, wie Leistungsprüfungen und Beurteilung der Tiere (Leistungsprüfungen sind die Grundlage für die Selektion).
Allerdings ist die Tierzucht in den letzten Jahrzehnten viel wissenschaftlicher geworden. Die Biotechnik hat eine Bedeutung gewonnen, die in früheren Jahren im Bereich der Tierhaltung kaum in diesem Ausmaß vorstellbar war. Die züchterische Nutzung neuentwickelter Biotechniken wie Embryotransfer beim Rind, der beginnende Einsatz von molekulargenetischen Gendiagnosen und der Gentransfer ist die Basis für weitere Verfahren der Reproduktionsbiologie, die jedoch noch in der wissenschaftlichen Entwicklung ist. Für die Zuchtplanung sind zu den genetischen Verfahren auch ökonomische Parameter notwendig.
Nutztierzucht wird international und national in Zukunft nur erfolgreich sein, wenn sie unter den gegebenen Rahmenbedingungen konkurrenzfähig ist.
Auch die Tierernährung verfolgte in den letzten Jahren das Ziel, die Ausnützung von Futtermitteln für die tierische Produktion zu verbessern. Die Qualität tierischer Erzeugnisse rückte in letzter Zeit immer mehr in den Vordergrund. Der Qualitätsbegriff umfasst rückstandsfreie Erzeugung tierischer Produkte.
Wir sind deshalb verpflichtet, die Schüler über den neuesten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Landwirtschaft zu informieren. Mehr Wissen bedeutet auch größere Chancen, einen Betrieb „gesund“ führen zu können, sowie sich kritisch mit den neuen Methoden der gentechnisch veränderten Lebensmittel auseinander zu setzen. Es reicht nicht, dem Schüler das BIO – Gedankengut im heutigen Sinne unserer Schule zu vermitteln, er muss selbstständiges Denken und erlerntes Wissen anwenden können.
Die Tierzucht (und damit auch die Festsetzung der Zuchtziele) verläuft seit jeher in enger Abhängigkeit von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und muss sich auch in Zukunft anpassen können. Letztlich sind es die Abnehmer und Verbraucher, die die Tierhaltung und Zuchtziele bestimmen, denn an ihren Wünschen orientiert sich die Tierzucht.
Aufgabe des Unterrichts ist es auch, die Irrwege der Hochleistungszucht aufzuzeigen. Das Tier muss immer im Mittelpunkt stehen als Mitgeschöpf, denn mit der Haltung unserer Nutztiere übernehmen wir Verantwortung für ihr Wohlbefinden.
Die landwirtschaftlichen Fachschulen sind gewissermaßen die Keimzellen der Zukunft des ländlichen Raumes. Die rasche Veralterung des Wissens macht es immer mehr erforderlich, bereits in der Erstausbildung zum lebensbegleitenden Lernen zu befähigen.
All dies ist nur möglich, wenn sich die landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg als offene Einrichtung versteht und mit den Absolventen zur anderen Bevölkerung der Region eine Brücke schlägt.
Ing. Matthias Weiß





